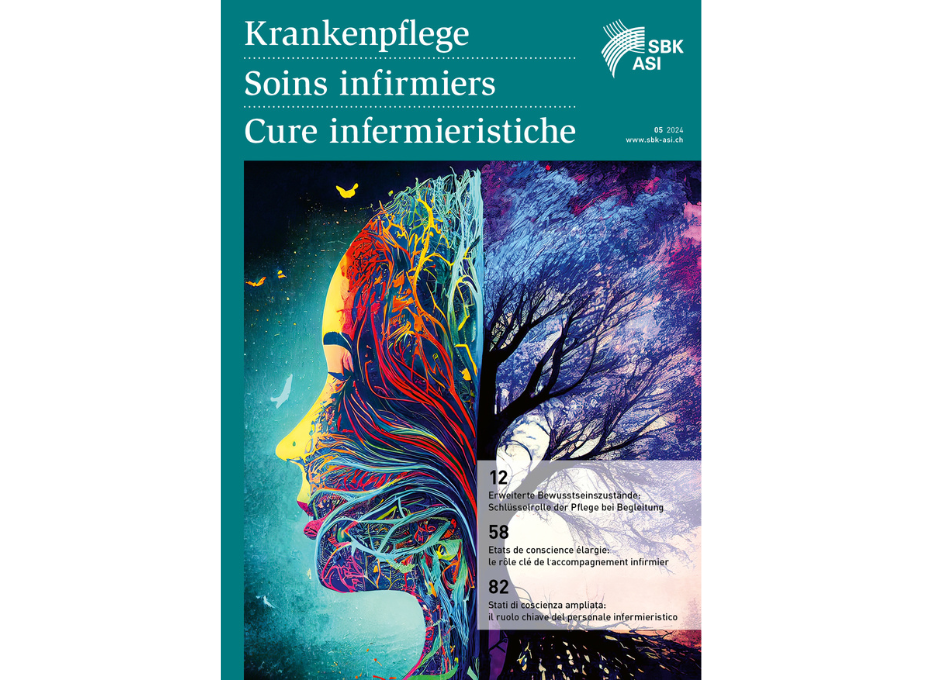
Es gibt wachsende Evidenz, dass Psychedelika bei der Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen wirksam sein können. Pflegefachpersonen bringen wertvolle Kompetenzen mit, um Menschen zu begleiten, die im Rahmen ihrer Therapie psychedelische Bewussstseinszustände erleben.
Text: Quentin Ulveling, Maxime Mellina
In der bewegten Geschichte der Psychedelika ist eine «Revolution» im Gange. Die lange verbotenen Substanzen werden in den USA und Europa immer öfter zur Behandlung von psychischen Erkrankungen eingesetzt. Es gibt wachsende wissenschaftliche Evidenz, dass sie bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, schweren Depressionen, Angststörungen sowie Suchterkrankungen wirksam sind. MDMA, auch bekannt als Ecstasy, befindet sich beispielsweise in den USA in Phase 3 der klinischen Studien und erhält wohl bald die Zulassung. Der US-Staat Oregon erlaubt zudem sogenannte «Healing Centers», wo Erwachsene in einer sicheren Umgebung Psilocybin konsumieren können.
In der Schweiz erhalten auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) eine wachsende Zahl von Ärzt:innen Ausnahmebewilligungen für die «beschränkte medizinische Nutzung» (compassionate use) von Psychedelika. Die Genfer HUG führen Begleitungen von Patient:innen unter Substanzeinfluss im Rahmen der «psychedelisch unterstützten Psychotherapie» (PAP) durch, ebenso die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich. PAP richten sich an Personen mit behandlungsresistenten psychischen Erkrankungen, das heisst bei denen Psychopharmaka und Psychotherapien keine längerfristige Besserung brachten. Ausnahmebewilligungen erteilt der Bund auch für die Forschung mit Psychedelika.
Rechtliche Grauzone
Diese Situation bringt die Substanzen heute in eine rechtliche Grauzone. Damit wird eine objektives Reflexion über mögliche gute Praktiken erschwert. Die wissenschaftliche Forschung wurde durch den «Krieg gegen Drogen» behindert. Dennoch wurden (und werden) Psychedelika weltweit weiter nicht-medizinisch genutzt, etwa zur Persönlichkeitsentwicklung oder Erforschung des Bewusstseins. Viele indigene Kulturen verwenden traditionellerweise psychedelische Substanzen, doch nur wenig Wissen und Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen fliessen in den aktuellen Wissensstand ein.
Seit einigen Jahren wird der medizinische Nutzen dieser Substanzen zunehmend anerkannt. Doch die Genehmigungen des Bundes für den «compassionate use» sind restriktiv. Sie sind schweren Fällen vorbehalten, da nachgewiesen werden muss, dass alle möglichen Therapien bereits versucht wurden. Die Organisation der PAP bleibt komplex, sowohl was die Kostenerstattung als auch was die Risiken betrifft.
Begleitung statt Tablette
Psychedelikaunterstützte Therapien beinhalten einen Paradigmenwechsel, wie die Therapien angegangen werden. Die Substanzen werden im Rahmen eines tiefgreifenden therapeutischen Prozesses eingesetzt, anders als die Behandlung mit Psychopharmaka. Zentrales Element ist die Art und Weise, wie die Erfahrung erlebt und begleitet (und finanziert) wird. In diesem Sinn muss über die Rolle der Pflege bei der Begleitung von Menschen nachgedacht werden, die im Rahmen ihrer Therapie die Erfahrung eines erweiterten Bewusstseinszustands durch psychedelische Substanzen machen.
Wie kann diese Rolle der Pflege konkret aussehen? Wie kann das Potenzial dieser Substanzen genutzt und das Risiko minimiert werden? Wie sieht die Begleitung während der Einnahme von Psychedelika aus? Wie kann traditionelles Wissen über die Verwendung von Psychedelika genutzt werden?
Antworten auf diese komplexen und vielfältigen Fragen sollten nicht einer Berufsgruppe überlassen werden und sie sollten auch nicht nur aus einer Perspektive betrachtet werden. Daher ist es wichtig, eine Debatte darüber zu führen, welchen Platz diese Substanzen in der Therapie, aber auch im gesellschaftlichen Kontext einnehmen können.
Herausforderungen einer Regulierung
Die GREA (Groupe Romand d'Etudes des Addictions; Westschweizer Forschungsgruppe Sucht) und der Verband Eleusis arbeiten seit einem Jahr mit über 30 Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um über mögliche Regulierungsmodelle für Psychedelika zu diskutieren. Ein kürzlich gegründeter Verein von Patient:innen mit PAP-Erfahrung trug ebenfalls dazu bei, die Grundlagen zu definieren:
Ein pragmatischer, nicht-ideologischer Ansatz, bei dem die Substanzen weder als Wundermittel verherrlicht noch als absolute Gefahr verteufelt werden, sondern der der Art und Weise Rechnung trägt, wie diese Substanzen genutzt werden.
Eine demokratische Vision, die erlaubt, dass jede Person die Möglichkeit hat, eine psychedelische Erfahrung unter sicheren Bedingungen zu machen, ausser es gibt klare Kontraindikationen.
Eine gesellschaftliche Vision, die den Konsum dieser Substanzen nicht nur im medizinischen, sondern auch im sozialen oder spirituellen Kontext betrachtet. Die aktuelle Zunahme von psychischen Erkrankungen ist eine Folge von tiefgreifenden gesellschaftlichen Disfunktionalitäten. Es reicht nicht, einen leidenden Menschen mit PAP zu behandeln und ihn dann in ein Umfeld zurückzuschicken, das sein Leiden überhaupt erst verursacht hat.
Eine interprofessionelle Perspektive, die die Kompetenzen der Fachpersonen und die Erfahrungen der Nutzer:innen einbezieht, um gute Praktiken zu entwickeln. So wird es möglich, einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem die Substanzen konsumiert werden.
Eine Durchsicht der pflegewissenschaftlichen Literatur der letzten zwei Jahrzehnte zeigt, dass sich die Pflege an der aktuellen Forschung zu Psychedelika nicht wesentlich beteiligte. Die mögliche Rolle der Pflege, die nachfolgend skizziert wird, sollte im Rahmen des interprofessionellen Ansatzes aber nicht vergessen werden.
Pflegekompetenz: Begleitung, Haltung, Benennen
Psychedelische Therapien erfordern persönliches Engagement, sowohl von der begleiteten als auch von der begleitenden Person. Die psychedelische Erfahrung ist das Herzstück der Intervention, eine Begleitung wird dringend empfohlen. Hier können die Kompetenzen genutzt werden, die Pflegefachpersonen durch ihren qualitativen und ganzheitlichen Ansatz und ihre Nähe zu den Menschen mitbringen.
Zentral ist dabei das Wissen («savoir-faire»). Pflegefachpersonen wissen, wie man auf Notfallsituationen reagiert und wie man für das Wohlbefinden und die Sicherheit von Patient:innen sorgt. Wie der Schriftsteller James Fadiman erklärt, ist bei einer psychedelischen Erfahrung die Übertragung (von Angst, Verweigerung, Macht, Anziehung usw.) unvermeidbar, muss erkannt und bewältigt werden. Wenn man eine Patientin oder einen Patienten begleitet, der sich in einer Krise befindet, geht es nicht darum, die Wirkung zu dämpfen, sondern einen sicheren Raum zu schaffen, in dem die Person diesen Prozess durchleben kann, ohne mit sich selbst oder anderen in Konflikt zu geraten. Krisen sind ein normaler Teil der menschlichen psychologischen Prozesse. Eine Möglichkeit, mit ihnen umzugehen, besteht darin, sie als Heilungsprozess zu betrachten und nicht als Problem, das gelöst werden muss. Solche Grundsätze können vor der psychedelischen Erfahrung definiert werden.
Zentral ist weiter die Haltung. Bei einer Person, die sich in einem erweiterten Bewusstseinszustand befindet, ist die Sensibilität erhöht und jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Die Professorinnen für Sozialarbeit Clémence Gauvin und Emilienne Laforge betonen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Haltung. Dazu gehört, dass man sich der eigenen kulturellen Prägung bewusst ist und sich davon distanziert, sowie Selbstvertrauen, Authentizität, Kreativität, Offenheit, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, die andere Person kennenzulernen. Eine ethische Frage bleibt, ob die begleitende Person selber über psychedelische Erfahrung verfügen sollte, um eine Beziehung auf der Grundlage einer gemeinsamen Sprache und Erfahrung aufbauen zu können.
Mit der Haltung entwickelt sich auch die Fähigkeit, die Erfahrung zu benennen und in Worte zu fassen. Das ist für die Begleitung und die Integration dieser im Kern unaussprechlichen Erfahrungen notwendig. Robert Krause, Doctor in Nursing Practice und Dozent an der Yale University, erklärt, dass eines der Probleme mit der Liberalisierung der Psychedelika darin besteht, dass wir in unserem Kulturkreis nicht über eine mythologische Sprache verfügen, um die Tiefe der Erfahrung zu verstehen. Andere Kulturen verfügen über einen mythologischen, religiösen oder spirituellen Kontext, um zu verstehen, was in diesen erweiterten Bewusstseinszuständen geschieht. In diesem Sinn besteht die Rolle der Pflege darin, eine hilfreiche Kommunikation zu ermöglichen und damit den Ausdruck von Emotionen, Gefühlen, Gedanken und Überzeugungen, die aus diesen Bewusstseinszuständen hervorgehen. Um die Integration der psychedelischen Erfahrung zu begleiten, können das «Gezeitenmodell» von Phil Barker und Poppy Buchanan-Barker oder das «aktive Zuhören» nach Carl Rogers in Betracht gezogen werden.
Präsenz als Grundelement des Caring
Im Zusammenhang mit der unterstützenden Kommunikation und der Notwendigkeit, Menschen in nicht-alltäglichen Bewusstseinszuständen zu begleiten, taucht ein grundlegendes Konzept von Pflege respektive des «Caring» wieder auf: die Präsenz. Die Verantwortung des Therapeuten oder der Therapeutin beim Aufbau einer therapeutischen Beziehung liegt in der Fähigkeit, authentisch präsent zu sein, indem er oder sie eine Haltung einnimmt, die Suzuki als «Geist des Novizen» beschrieben hat. In einem Umfeld, in dem die Ressourcen oft begrenzt sind und die Pflegenden mit einer hohen Arbeitsbelastung konfrontiert sind (Ausführung von Aufgaben nach Protokollen, steigende Patient:innenzahlen, Probleme mit Engpässen), kann es schwierig scheinen, diese Präsenz aufrechtzuerhalten.
Wenn sich jedoch der oder die Therapeut:in vom Drang befreit, etwas «tun» zu müssen, wird Raum für Neugier und Urteilsfreiheit und damit der Entwicklung geschaffen. Die Rolle der begleitenden Person beschränkt sich darin, Lösungen anzubieten. Sondern sie konzentriert sich darauf, vollkommen präsent zu sein, um die Person zu verstehen. Die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Jean Watson nennt es «authentische Präsenz», ihre Kollegin Rosemarie Rizzo Parse «wahre Präsenz». Präsenz stellt den Raum her, der einer Person die Möglichkeit bietet, in ihrem aussergewöhnlichen Bewusstseinszustand sinnvoll begleitet zu werden.
Die Begleitung muss zweifellos interprofessionell sein, aber die Besonderheiten der Pflege sind von entscheidender Bedeutung. Mehrere von Janis Phelps identifizierte therapeutische Schlüsselkompetenzen wie die empathische Präsenz oder die Stärkung des Vertrauens des/der Patient:en, damit angeborene Heilkräfte zum Vorschein kommen können, entsprechen den Grundsätzen der Pflege. Pflegefachpersonen sind bei allen Wendepunkten des Lebens präsent – Geburt, Tod, und bei psychischen Krisen. Dort entfaltet der für die Pflege spezifische Prozess der «Caritas» seine volle Bedeutung. Er besteht darin, «eine heilende Umgebung für das körperliche und geistige Selbst zu schaffen, die die Menschenwürde respektiert» und «die Person in ihren grundlegenden körperlichen, emotionalen und geistigen menschlichen Bedürfnissen unterstützt», das heisst eine «Caring-Healing»-Pflege anbietet. Das ist zentral in der «Black Box» des therapeutischen Prozesses mit Psychedelika. Er könnte durchaus autonom von Pflegefachpersonen ausgeführt werden und ein Teil des eigenständigen Bereichs der Pflege werden.
Diese Haltung erlaubt möglicherweise auch eine Art transpersonale spirituelle Intelligenz. Sie fordert die begleitenden Person auf, für die transzendenten und existenziellen Mysterien offen zu sein, den die Person durchmacht. Zum Selbstverständnis und zur ethischen Integrität gehört auch die Wahrung von Grenzen, der Umgang mit Macht und Übertragungs-/Gegenübertragungsfragen. Die Pflege kann dank ihrer Vielseitigkeit auf einzigartige Weise in den Bereich der Psychedelika zum Einsatz kommen. Ihre Kompetenzen, die vom Wissen über der Wirkung von Psychedelika bis zum Einsatz von komplementären Methoden reichen, positionieren Pflegefachpersonen in besonderer Weise in diesen Therapien.
Auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel?
Das Revival der Psychedelika stellt einen Paradigmenwechsel in der Medizin dar: Der Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Patient:in und Therapeut:in und nicht auf der medikamentösen Behandlung. Dem Patienten, der Patientin wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die Verschreibung von Psychedelika sollte daher nicht als Pharmakotherapie betrachtet werden, sondern als tiefgreifender therapeutischer Prozess. Die Erfahrungen, die auf einen erweiterten Bewusstseinszustand beruhen, können dazu beitragen, dass sich Menschen wieder mit sich selbst verbinden und mit psychischen und existenziellen Herausforderungen des Lebens umgehen können. Die Pflege kann bei hier eine wesentliche Rolle spielen.
Aktuell ist der Zugang zu diesen Therapien eingeschränkt, auch wegen der hohen Kosten. Dazu trägt auch die Anforderung bei, dass während des ganzen Prozesses eine ärztliche Fachperson anwesend ist. Eine Aufwertung der Kompetenzen der Pflegefachpersonen, der Nutzer:innen und der Menschen, die Erfahrung mit Psychedelika haben, könnte eine Lösung sein, um die Therapie zugänglicher und finanzierbar zu machen, während und Sicherheit und Ethik respektiert werden.
Es wäre auch sinnvoll, die indigenen Praktiken und das indigene Wissen anzuerkennen, die in der westlichen Welt unter dem Begriff Schamanismus zusammengefasst werden. Diese Erfahrungen könnten in Kombination mit westlichem Wissen Therapien mit Psychedelika bereichern. Was könnte unsere Gesellschaft von ihnen lernen? Welche Beispiele gibt es, denen wir nicht folgen sollten? Die Pflegefachpersonen können auch dazu einen Beitrag leisten und über den medizinischen Bereich hinaus ihre Kompetenzen einbringen, indem sie in der Prävention, Risiko–minderung, Information, Bildung und Begleitung aktiv werden.

Dieser Schwerpunkt erschien in der Ausgabe 5/2024 der Krankenpflege, der Fachzeitschrift des SBK.
11 Mal pro Jahr erscheint die dreisprachige Fachzeitschrift für die Pflege. Mitglieder des SBK erhalten sie frei haus. Andere Interessierte können die Fachzeitschrift abonnieren. Ein Jahresabonnement kostet 99 Franken.




